IGF-Leitfaden (Stand: Oktober 2011)

[<<] [>>]
[Inhaltsübersicht] [Volltextsuche] [Historie] [Druckversion]

1. Grundlagen
1. Grundlagen
1.1 Rechtsgrundlagen
1.1 Rechtsgrundlagen
Das BMWi fördert Vorhaben der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) nach Maßgabe der jeweils gültigen
Richtlinie über die Förderung der
Industriellen Gemeinschaftsforschung und -entwicklung und der
Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Bundeshaushaltsordnung nebst dazugehörigen
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung. Weitere Rechtsgrundlagen sind das
Verwaltungsverfahrensgesetz (insbesondere §§ 48, 49, 49a) und die
Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen (VOL).
Darüber hinaus sind der
Corporate Finance Codex (CFC)
sowie die
Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der IGF zu beachten.
1.2 Definition der IGF
1.2 Definition der IGF
IGF besteht in solchen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die von einer repräsentativen Mehrheit kleiner und mittlerer Unternehmen einer industriellen Wirtschaftsbranche oder eines industriellen Technologiefeldes im Rahmen einer entsprechenden Forschungsvereinigung der AiF gemeinsam vorwettbewerblich betrieben werden. Sie ermöglicht mittelständischen Unternehmen, wirtschaftlichen Nutzen aus den für die Unternehmen gleichermaßen zugänglichen Forschungsergebnissen zu ziehen und dadurch ihre strukturbedingten Nachteile auf dem Gebiet von Forschung und Entwicklung teilweise auszugleichen. Auf der Grundlage dieser Forschungsergebnisse der IGF können die Unternehmen firmenspezifische Lösungen für neue Verfahren, Produkte und Dienstleistung entwickeln, um so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
IGF bezieht sich auf Forschungsaktivitäten,
die gemeinsam von Unternehmen innerhalb einer Wirtschaftsbranche oder eines Technologiefeldes durchgeführt werden,
die vorwettbewerblichen Charakter haben [Details ein-/ausblenden],
Die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) ist auf eine unternehmensübergreifende,
branchenweite Nutzung von Ergebnissen ausgerichtet. Die Ergebnisse dürfen nicht zu
einseitigen Wettbewerbsvorteilen für einzelne Unternehmen führen. Eine exklusive
Nutzung von Ergebnissen durch ein oder mehrere Unternehmen ist in jedem Fall unzulässig.
Die Vorwettbewerblichkeit muss zunächst in der Ausführlichen
Beschreibung sowie in der Kurzbeschreibung zum Forschungsantrag klar zum Ausdruck kommen. Um grundsätzlichen Zweifeln an der Vorwettbewerblichkeit von vornherein zu begegnen, sollten
zudem im Projektbegleitenden Ausschuss mindestens zwei Unternehmen (möglichst
KMU) mitwirken, die als mögliche Nutzer der Ergebnisse dieses IGF-Vorhabens in Betracht
kommen.
Bei der Entwicklung von allgemein nutzbaren Normen, Standards, Berechnungsvorschriften,
Qualitätsanforderungen etc. ist das Kriterium der Vorwettbewerblichkeit der
Ergebnisse in der Regel erfüllt.
Vorwettbewerblichkeit der Ergebnisse ist auch gegeben, wenn Forschung betrieben wird,
die den Charakter von Grundlagenforschung hat.
Bei der Schaffung von Grundlagen für die Entwicklung neuer oder deutlich verbesserter
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen ist das Kriterium der Vorwettbewerblichkeit
der Ergebnisse erfüllt, wenn diese Ergebnisse allen Interessenten diskriminierungsfrei
zur breiten Nutzung zur Verfügung stehen.
Sonderfälle:
Erstellung eines Funktionsmusters
Die Erstellung eines Funktionsmusters (Demonstrators) ist mit dem Kriterium der Vorwettbewerblichkeit
vereinbar. Die außerhalb des Vorhabens erforderliche Entwicklung
vom Funktionsmuster (Demonstrator) zum Serienprodukt bzw. von einer
Technikumsanlage zu einer Produktionsanlage ist in der Ausführlichen
Beschreibung sowie in der Kurzbeschreibung zum Forschungsantrag nachvollziehbar darzustellen.
Erstellung eines Prototyps
Nicht vereinbar mit dem Kriterium der Vorwettbewerblichkeit ist hingegen die Erstellung
eines Prototyps, der unmittelbar in die Produktion übernommen werden kann.
deren Ergebnisse einen Nutzen und eine wirtschaftliche Bedeutung insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben [Details ein-/ausblenden],
Die Ergebnisse eines IGF-Vorhabens müssen in der Regel für KMU unmittelbar nutzbar
sein und nicht erst über den Umweg in größeren Unternehmen (d.h. in Unternehmen mit
mehr als 125 Mio. € Jahresumsatz). Dies kann bei der Entwicklung von Normen, Standards,
Berechnungsvorschriften, Qualitätsanforderungen etc. vorausgesetzt werden.
In vielen Branchen arbeiten KMU und größere Unternehmen jedoch mit verteilten FuE-Zuständigkeiten
zusammen. Diese Arbeitsteilung in der Wirtschaft und der systemische
Charakter eines Forschungsthemas kommt durch Kooperation von KMU mit größeren
Unternehmen in einem IGF-Projekt und im Projektbegleitenden Ausschuss zum Ausdruck.
Dabei kann es sich in Einzelfällen auch um einen mittelbaren Nutzen für KMU
handeln, etwa durch gemeinsame Systementwicklung mit größeren Unternehmen oder
durch Nutzung von Umsetzungen in größeren Unternehmen als Voraussetzung für eigene
neue Systemkomponenten bei KMU. Als Beispiel für eine gemeinsame Systementwicklung
mit größeren Unternehmen kann die Entwicklung eines neuen Motorenkonzeptes
für große Motorenhersteller mit Zielvorgaben für anschließende Detailentwicklungen
durch KMU wie Prüfsysteme, Messtechnik, Sensorik und Simulation genannt werden. Im
Fall des mittelbaren Nutzens muss dies bereits im Antrag auf Begutachtung (Phase 1)
deutlich werden. Darüber hinaus müssen die zur Mitarbeit im Projektbegleitenden Ausschuss
vorgesehenen KMU ihr systembezogenes Interesse an dem konkreten IGF-Projekt im
Antrag auf Bewilligung (Phase 2) schriftlich bekundet haben.
die in den Gremien der verantwortlichen Forschungsvereinigungen der AiF beraten werden und über deren Antragstellung in diesen Gremien entschieden wird,
die von Unternehmen begleitet werden (Projektbegleitender Ausschuss),
deren Ergebnisse aktiv durch die Forschungsvereinigungen und Forschungsstellen verbreitet und veröffentlicht werden.
1.3 Gegenstand der Förderung
1.3 Gegenstand der Förderung
Die Förderung der FuE-Vorhaben erfolgt subsidiär und besteht in der Gewährung einer nicht rückzahlbaren Zuwendung. Die Zuwendung wird als Projektförderung in Form einer modifizierten Anteilfinanzierung in Höhe der nachgewiesenen, aus der Zuwendung zu finanzierenden Ausgaben für ein inhaltlich (
Zuwendungszweck) und zeitlich (
Bewilligungszeitraum) definiertes Projekt gewährt. Voraussetzung ist, dass der
Antragsteller Aufwendungen der Wirtschaft für das IGF-Vorhaben in angemessener Höhe nachweisen kann.
Förderfähig sind wissenschaftlich-technische Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die unternehmensübergreifend ausgerichtet sind, neue Erkenntnisse vor allem im Bereich der Erschließung und Nutzung moderner Technologien erwarten lassen und damit Grundlage für Produkt-, Verfahrens- und Dienstleistungsinnovationen insbesondere in KMU bilden können. Dazu müssen die Anträge zu den FuE-Vorhaben Vorschläge für den Transfer in die Wirtschaft, Aussagen zur Umsetzbarkeit und zur wirtschaftlichen Bedeutung enthalten. Die vorgesehene Laufzeit eines Vorhabens soll nicht mehr als drei Jahre betragen. Bei einer beantragten Laufzeit von mehr als 30 Monaten ist deren Notwendigkeit schlüssig darzulegen.
Nicht förderfähig sind Vorhaben,
- die ganz oder teilweise im Auftrag Dritter durchgeführt werden,
- die im Rahmen anderer technologieorientierter Programme des Bundes, der Länder oder der Europäischen Union gefördert werden,
- die zu einseitigen Wettbewerbsvorteilen einzelner Unternehmen führen können,
- die überwiegend der wissenschaftlichen oder beruflichen Aus- und Fortbildung dienen,
- mit denen zum Zeitpunkt der Förderentscheidung des BMWi schon begonnen worden ist.
Neben der allgemeinen Förderung im Rahmen der IGF (
Normalverfahren) gibt es die Fördervarianten
ZUTECH (
Zukunftstechnologien für KMU),
CORNET
(transnationale FuE-Projekte im Rahmen einer europäischen Initiative zu
Collective Research) und
CLUSTER.
1.4 Antragsberechtigte
1.4 Antragsberechtigte
Antragsberechtigt sind die rechtlich selbständigen Forschungsvereinigungen, die ordentliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e.V. (AiF) sind, die laut Satzung der AiF ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgen müssen, die im Prinzip für alle interessierten Kreise offen sind und, soweit sie wirtschaftlich tätig sind, die Voraussetzungen für gemeinnützige Forschungseinrichtungen im Sinne des
Transparenzrichtlinie-Gesetzes erfüllen [
Details ein-/ausblenden].
Damit übernehmen die AiF-Forschungsvereinigungen, in deren Beratungsgremien die Prüfung und Auswahl der Forschungsvorschläge aus den Unternehmen und Forschungsstellen erfolgt, ebenso wie die endgültige Themenfindung und die Ausarbeitung der Vorschläge zu konkreten Forschungsvorhaben, eine Schlüsselfunktion. Sie haben zu entscheiden, ob sie ein Vorhaben aus eigenen Mitteln finanzieren oder ob sie eine öffentliche Förderung beantragen. Soll das Vorhaben aus Mitteln des BMWi gefördert werden, richtet die jeweilige AiF-Forschungsvereinigung einen ausführlichen Antrag an die AiF nach einem Verfahren, das in den folgenden Abschnitten näher beschrieben wird.
Sofern die AiF-Forschungsvereinigungen als Erstzuwendungsempfänger die Vorhaben nicht selbst durchführen, kann die
Bearbeitung ganz oder teilweise durch andere rechtlich selbständige, gemeinnützige Forschungsstellen (Letztzuwendungsempfänger) vorgesehen werden [
Details ein-/ausblenden].
Diese Forschungsstellen müssen über die zur Bearbeitung des jeweiligen Vorhabens erforderliche wissenschaftliche Qualifikation und eine für die bestimmungsgemäße Mittelverwendung notwendige Administration verfügen.
Für die Bearbeitung eines Forschungsvorhabens können auch nicht gemeinnützige Forschungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland oder Forschungsstellen im Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) vorgesehen werden, wenn diese bestmögliche Forschungsergebnisse erwarten lassen. Für nicht gemeinnützige und für ausländische Forschungsstellen sind besondere Regeln zu beachten, auf deren Grundlage im konkreten Einzelfall entschieden werden muss.
Nicht antragsberechtigt sind einzelne Unternehmen oder Forschungseinrichtungen.
1.5 Systematik des Verfahrens
1.5 Systematik des Verfahrens
Das Verfahren zur
Beantragung einer Zuwendung zur Durchführung eines Forschungsvorhabens besteht aus zwei Phasen:
Der Antrag in Phase 2 wird von der AiF-Forschungsvereinigung über die AiF an das BMWi gestellt. Die Zusammenstellung der Antragsunterlagen erfolgt in der AiF.
Während der
Durchführung des Vorhabens sind vom Zuwendungsempfänger
Nach Abschluss des Vorhabens sind vom Zuwendungsempfänger
- die Verwendung der Zuwendung und die vorhabenbezogenen Aufwendungen der Wirtschaft (vAW) nachzuweisen,
- Ergebnisse zu veröffentlichen und aktiv in die Wirtschaft zu transferieren.
1.6 Projektbegleitender Ausschuss (PA)
1.6 Projektbegleitender Ausschuss (PA)
Der Projektbegleitende Ausschuss (PA) soll ein Steuerungs- und Beratungsgremium für die Forschungsstelle sein, das die Belange der Praxis, insbesondere die der KMU, von der Planung und Bearbeitung eines Vorhabens bis zur Darstellung der Ergebnisse immer wieder in den Mittelpunkt stellt. Die Mitarbeit im Projektbegleitenden Ausschuss muss unabhängig von einer Mitgliedschaft in der Antragstellenden AiF-Forschungsvereinigung möglich sein.
Für die Zusammensetzung des Projektbegleitenden Ausschusses gelten bestimmte Voraussetzungen
[Details ein-/ausblenden].
Der Projektbegleitende Ausschuss muss wenigstens drei Mitglieder aus der Wirtschaft haben.
Dem Projektbegleitenden Ausschuss sollen mindestens zur Hälfte oder mindestens fünf Vertreter interessierter KMU angehören.
Dabei zählen mehrere Angehörige einer vertretenen Stelle nur einfach.
Mitglieder des Projektbegleitenden Ausschusses für ein IGF-Projekt sind:
- Mitglieder aus der Wirtschaft
- Sonstige Mitglieder
Dazu gehören insbesondere Angehörige von sonstigen Vereinen und von sonstigen Forschungsstellen (z.B. von Hochschulen).
Angehörige der das jeweilige Projekt durchführenden Forschungsstelle(n) können nicht zu den Mitgliedern des Projektbegleitenden Ausschusses gezählt werden, weil sie sich nicht selbst begleiten können.
Wenn die Antragstellende Forschungsvereinigung zur Durchführung eines IGF-Vorhabens eine Kooperationsvereinbarung mit einer weiteren oder mehreren Forschungsvereinigungen abschließt, ist ein Projektbegleitender Ausschuss unter Einbeziehung aller am Vorhaben beteiligter Forschungsvereinigungen zu bilden. Eine kooperierende Forschungsvereinigung muss jedoch nicht selbst im Projektbegleitenden Ausschuss vertreten sein. Es ist auch zulässig, dass ein Vertreter eines von ihr benannten Unternehmens der eigenen Branche in den Sitzungen des Projektbegleitenden Ausschusses mitwirkt.

[<<] [>>]
[Inhaltsübersicht] [Volltextsuche] [Historie] [Druckversion]
[Druckversion des kompletten Leitfadens ohne Details aufrufen]
[Druckversion des kompletten Leitfadens einschließlich aller Details aufrufen]
Eine Auflistung der Dokumente, auf die der IGF-Leitfaden Bezug nimmt, finden Sie
unter Vordrucke bzw. Rechtsgrundlagen, Arbeitshilfen
und Muster.

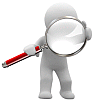
![]()
![]()
![]()
![]()